

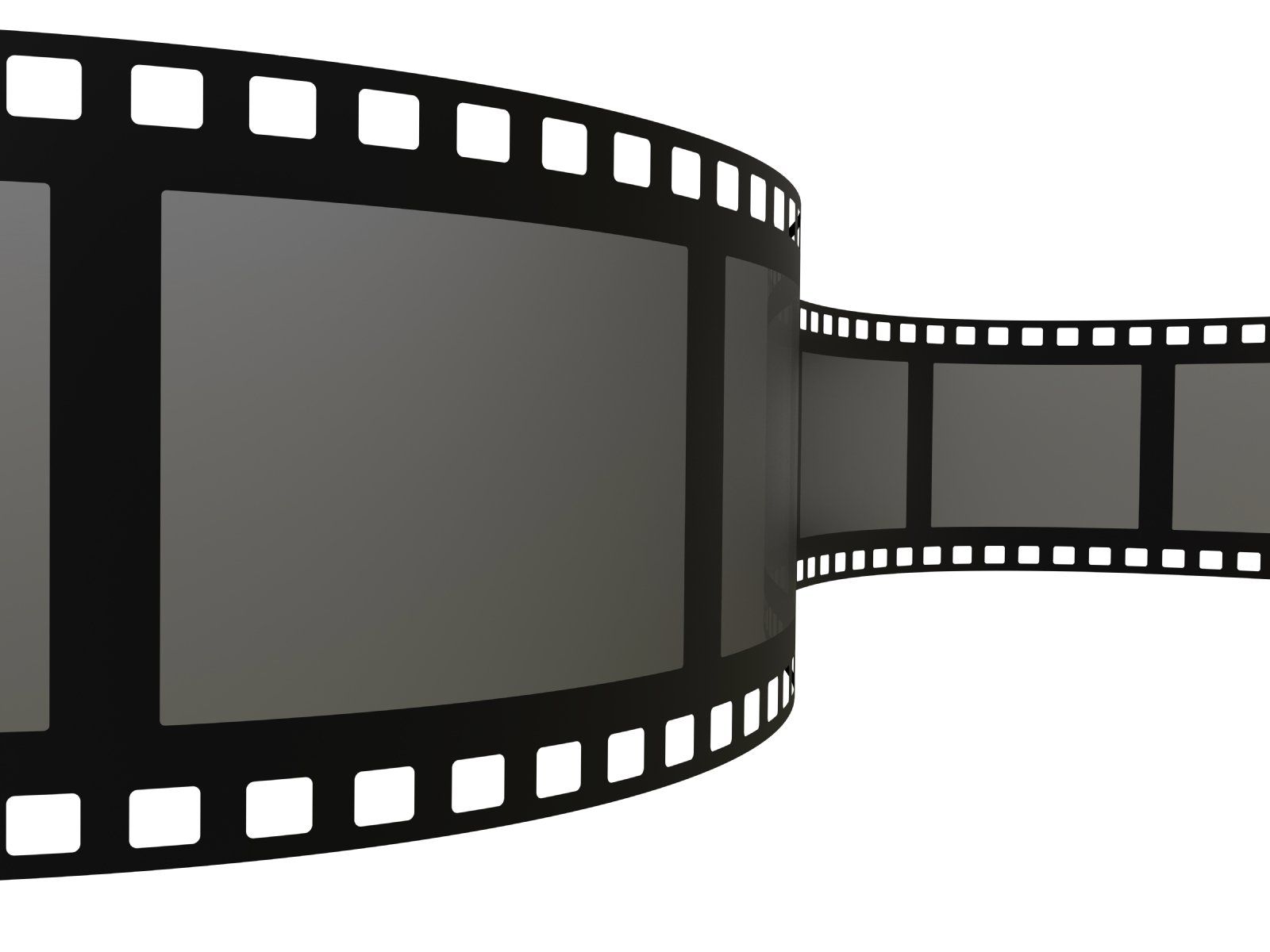
Die Fake-News-Falle
Wenn reale Bedrohung zur Hysterie wird
Das Verbreiten von Gerüchten und Falschmeldungen gehört zu den ältesten Mitteln der Macht. Früher waren nur wenige Teilnehmer involviert. Über die sozialen Netzwerke ist heute jeder Nutzer, sei es als Einzelperson, sei es als Unternehmen, als Partei oder Vereinigung welcher Couleur auch immer, sein eigener Newsproduzent und damit ein potenzieller Verbreiter von nicht verifizierten Inhalten.
Während sich ausgebildete Journalisten und etablierte Medienhäuser einem Kanon von Rechten und Pflichten verpflichtet fühlen mit festen Spielregeln und Sanktionsmöglichkeiten, werden in den sozialen Netzwerke teils aus Unwissenheit, teils aus Berechnung zunehmend die Grenzen von Meinungsäußerung und Informationsverbreitung strapaziert. Die Auswahl von „Nachrichten“ reduziert sich dabei zu einem Spiegel der persönlichen Einstellung gegenüber Themen und Personen. Die Zigstelsekunden-Entscheidung für einen Mausklick bewegt sich jenseits jeder Quellenbewertung. Der Schneeballeffekt der Netzwerkverbreitung potenziert die Verbreitungsgeschwindigkeit gegenüber klassischen Medien.
Parallel zu dieser Entwicklung nimmt das Vertrauen in die etablierten Medien ab. Die Diskussion um „Lügenpresse“ zeigte das Mitte 2016 deutlich. In einer Umfrage durch Infratest dimap von Januar 2017 im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks hielten 42 Prozent der Befragten die Medien für nicht glaubwürdig, 37 Prozent gaben an, dass ihr Vertrauen in die Medien gesunken sei (6 Prozent: „ist gewachsen“, 57 Prozent „hat sich nicht so viel verändert“).
Medienkenner befürchten für den anstehenden Bundestagswahlkampf eine bisher in Deutschland nicht gekannte „Schlacht“ um die Meinungshoheit im Netz. Da geht es nicht mehr nur darum, wer seine Parteimitglieder und Sympathisanten am besten mobilisieren kann. Es geht auch um eine technische Aufrüstung mittels Robotern, die sich hinter Nutzerprofilen verbergen. Und es geht um bewusste Diffamierung von Konkurrenten – nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft.
Klaus Methfessel hat im Whitepaper „Fake News“ , das Fakten + Köpfe im Frühjahr herausgegeben hat, drei fundamentale Thesen zum Umgang der Medien mit Fake News formuliert, an die sich die Medienschaffenden erinnern sollten, wenn sie das Thema mit Blick auf den Bundestagswahlkampf aufgreifen:
- Die einzigen wirklich wirksamen Mittel gegen Fake News sind auf Dauer die Vielfalt und der Wettbewerb der Medien.
- Die journalistischen Tugenden Recherchieren und Faktencheck geraten angesichts des Schnelligkeitswettbewerbs, in dem vor allem die Online-Portale stehen, ins Hintertreffen.
- Bei Fake News sind
Journalisten nicht immer Opfer von bewussten Desinformations-kampagnen,
sondern häufiger noch Opfer der eigenen Schludrigkeit.
