
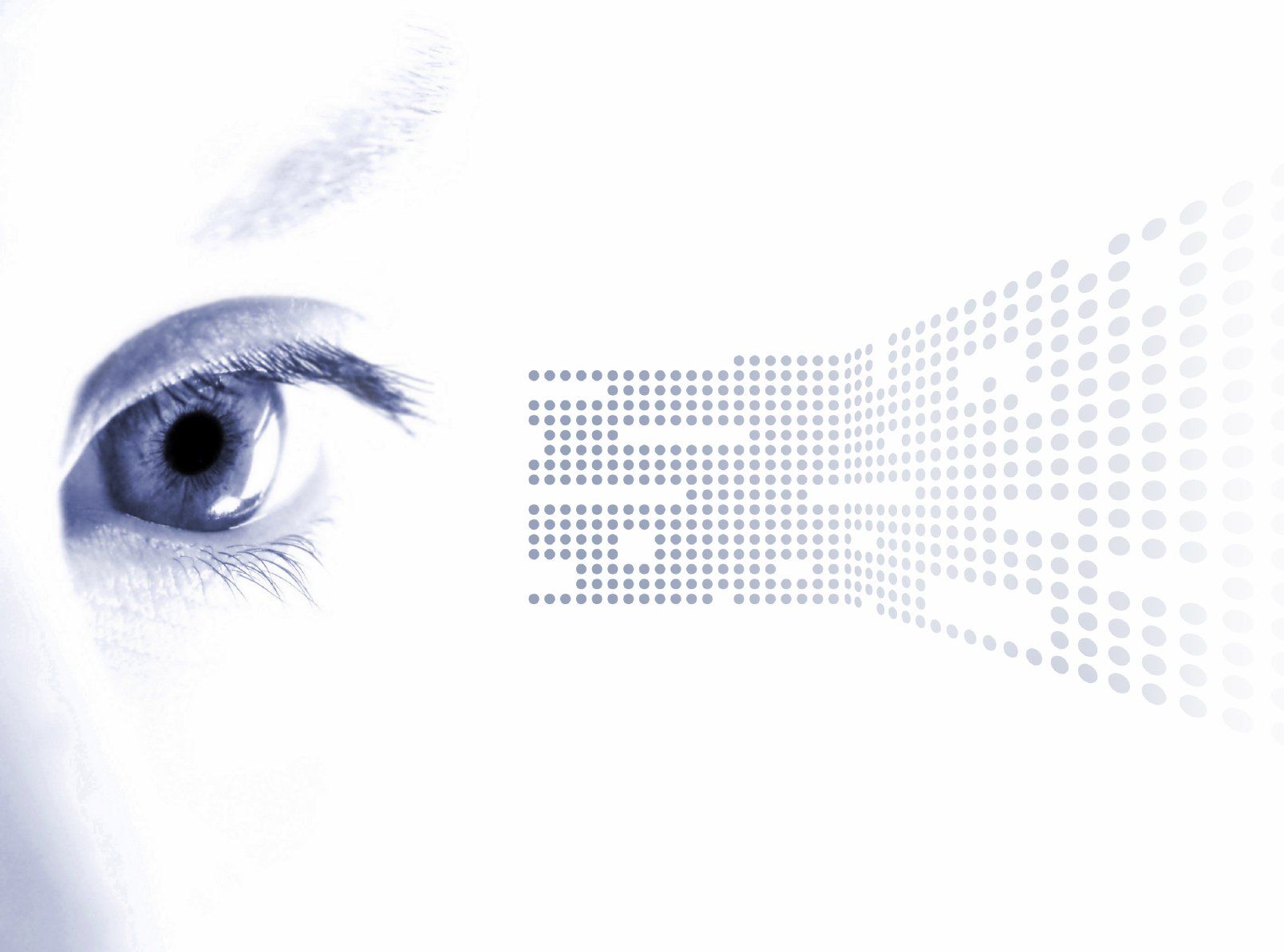
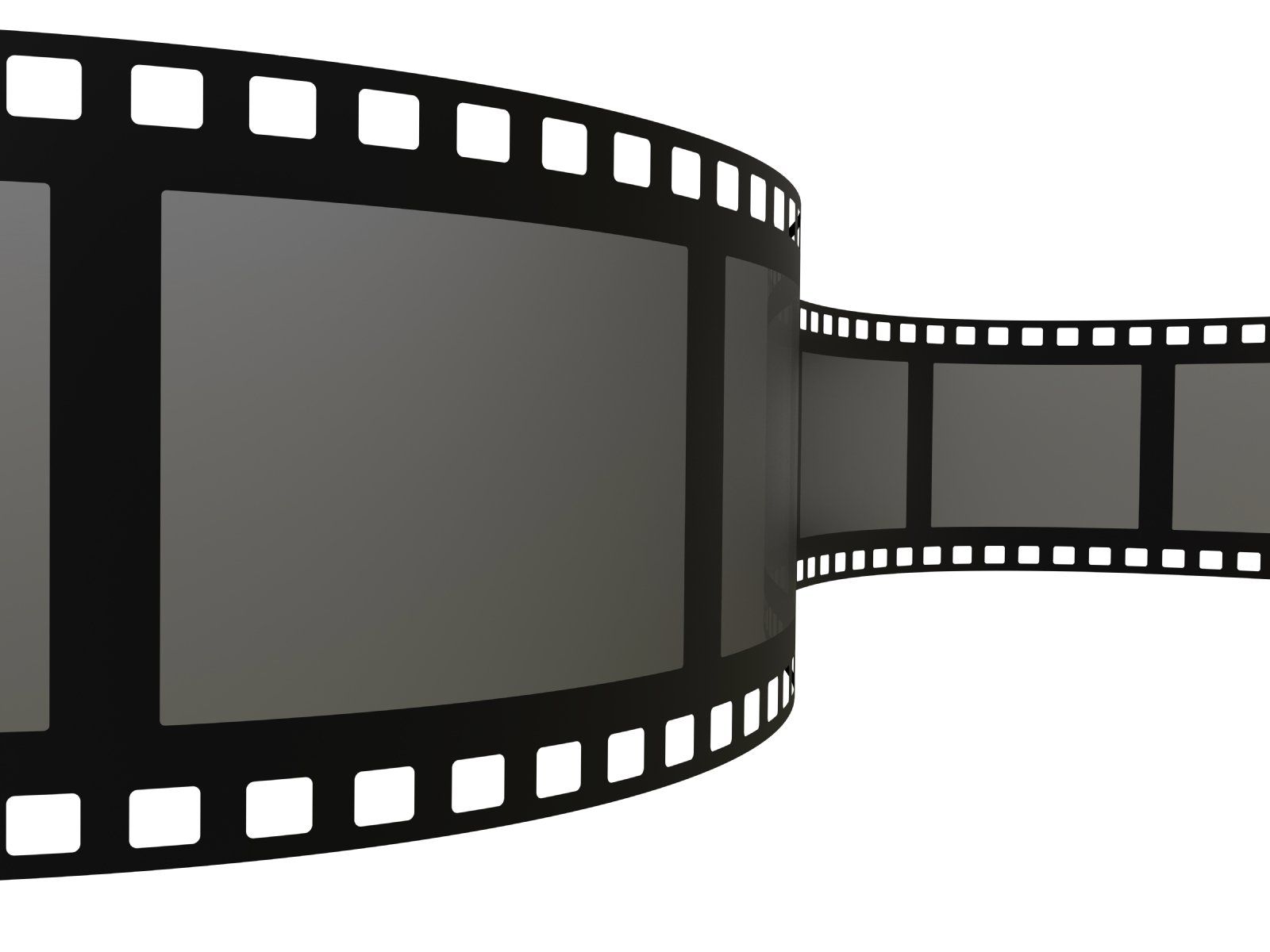

Gäckler, Gabenfresser, Juchheier: alte Wörter neu entdeckt
In die Wörterwunderkiste gegriffen
Anliebeln ist so ein Wort. Oder mieneln. Wörter, die es mal gab und die man gerne wieder in die deutsche Sprache einführen würde. Das entzückende Anliebeln bedeutete einst, „einen mit verliebten Augen ansehen“, mieneln meinte „die Mienen spielen lassen“. Das allerschönste aber ist entlästigen , das ich von heute an anlieble. Es ist der Gegensatz zu belästigen, es bedeutet so etwas wie „frei werden von“. Wunderbar! Ab sofort entlästige ich mich all meiner Arbeits- und weiteren Pflichten!
Peter Graf hat sie ausgewählt und auf 351 Seiten herausgegeben, lauter heute weitgehend unbekannte Wortschönheiten aus dem monumentalen Wörterbuch der deutschen Sprache von Jacob und Wilhelm Grimm. Die Märchenbrüder hatten die Arbeit am Deutschen Wörterbuch 1838 begonnen. Als es 123 Jahre später mit Band 33 abgeschlossen wurde, umfasste es über 320.000 Einträge auf 34.824 Seiten.
Wie bei mieneln gibt es weitere Verben, die wir heute nicht mehr kennen. Wir haben zwar teilweise das passende Substantiv, müssen aber das Tun mit seiner Hilfe umschreiben. Weil ich mich aller meiner Pflichten auf einen Schlag entlästige, verursache ich einen Tumult, früher hieß das kurz und bündig tumultuieren . Oder es gab, herrlich, spitzfindeln . Manches existiert auch heute noch, verschlampen zum Beispiel. Oder salbadern .
Nicht nur Verben, auch verschollene Substantive füllen die Seiten von Grafs Buch. Ein Ausruf ausgelassener Freude, der heute noch bekannt ist, aber so gut wie nicht mehr benutzt wird, ist „juchhei“. Im Bergischen geläufig ist noch heute „auf den Juchhei gehen“, wenn man ausgeht, um sich einen fröhlichen Abend zu machen. Getoppt wird das von dem Grimmschen Juchheier , welcher ein ausgelassener Mensch ist. Die Juchheier möchten einer Spezies gar nicht begegnen, und das sind die Freudenräuber . Ihnen geht man aber ganz generell lieber aus dem Weg, genau wie in eher akademischen Runden dem Gedächtnisgelehrten , da dieser mit seinem „blosz gedächtnismäßigem Wissen“ die Gesellschaft sehr ermüdet. Andere nervende Mitmenschen sind zum Beispiel die Ichlinge : die Egoisten. Oder die Gäckler , die ewigen Schwätzer, die einen zur Weißglut treiben. Wen man am besten gar nicht erst ernst nimmt, ist den Kurzdenker . Leider aber bevölkern Leute, die nicht weit denken, nicht nur den banalen Alltag, sondern bekleiden auch wichtige öffentliche Posten. Hier führen besonders die Gabenfresser ein angenehmes Leben, das sind Richter, die Bestechungen annehmen. Dieser Begriff könnte aber ohne weiteres eine Bedeutungserweiterung auf andere Berufsgruppen erfahren.
Ach, all die Freudenfresser, Gäckler, Kurzdenker und Gabenfresser: Sie verursachen mir - und damit komme ich zum Höhepunkt - eine große Gemütsabmattung. Ein Wort, das keinen erklärenden Eintrag erhalten hat und auch keinen benötigt. Solcherart gemütsabgemattet, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mich von allem zu entlästigen.
Eine ungemein
eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch.
Ausgewählt und herausgegeben von Peter Graf.
Dritte Auflage 2018. Verlag Das
kulturelle Gedächtnis
, Berlin.
